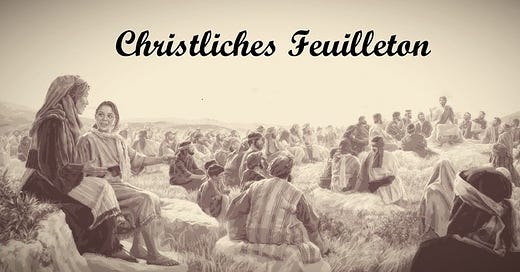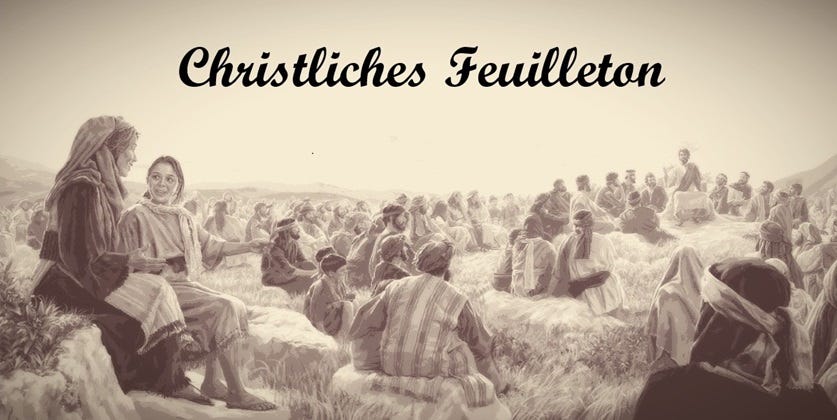Karfreitag in Berlin: Die Kirche auf dem geistlichen Irrweg
24.04.2025 Ein nackter queerer Künstler, eine Imamin im Hijab – der geistliche Irrweg der deutschen Kirche
„Hört auf Luisa!“, schreit ein Klimaforscher. Ein nackter Künstler verspritzt Schlamm. Und „Kein Mensch ist illegal“ gehört zur Liturgie. Was auf der ökumenischen Karfreitagsprozession in Berlin geschah, übertrifft jedes Klischee von Aktivismus und Moralismus. Am diesjährigen Karfreitag nahm ich an der ökumenischen Karfreitagsprozession durch Berlin teil – als katholischer Christ, um an das Leiden und Opfer Jesu Christi zu erinnern.
Die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat der Kirche zuletzt Fehler vorgeworfen: „Wenn Kirche manchmal zu beliebig wird oder zu tagesaktuellen Themen Stellungnahmen abgibt wie eine NGO und nicht mehr die grundsätzlichen Fragen von Leben und Tod im Blick hat“, sagte die CDU-Politikerin gegenüber der „Bild am Sonntag“, „dann wird sie leider auch austauschbar.“ Was ich erlebte, war kein Kreuzweg, sondern ein Spiegel der Gegenwart. Er bestätigt Klöckners Kritik. Die Kirche wankt einen geistlichen Irrweg zwischen sakralem Ernst, gesellschaftlichem Aktivismus und moralischer Performance entlang. Der Weg führte vom lutherischen Gotteshaus St. Marien zur katholischen Sankt-Hedwigs-Kathedrale – ein symbolischer Bogen, gegangen von rund 250 Personen. Protestantische, katholische und griechisch-orthodoxe Veranstalter hatten sich zusammengeschlossen – einzeln hätten sie die nötige Beteiligung kaum erreicht. Die Zahl der Teilnehmer blieb überschaubar, kleiner als jede spontane Kundgebung israelfeindlicher Palästina-Demonstranten.
Angeführt wurde der Zug von einem drei Meter hohen und rund 80 Kilogramm schweren Holzkreuz. Es erinnerte an die mittelalterlichen Kreuzwege, in denen das Leiden Christi in eindrücklichen Bildern vergegenwärtigt wurde. Auch die eigentliche Prozession arbeitete mit Bildern – aber es waren andere.
Karfreitag in Berlin: Vom Kreuzweg zur Performance
Ein Künstler, nackt, mit Schlamm beschmiert und in Ketten gelegt, schrie und schleuderte Schlamm auf den Asphalt. Sein Körper, sein Auftritt – Teil einer Performance gegen die Diskriminierung queerer Menschen in Ghana. So hatte eine protestantische Geistliche ihr Mitlaufen bei der Prozession kurz vorher erklärt. Flankiert von einem Kamerateam und einem Kollektiv, das alles dokumentierte, bewegte er sich mit uns. Mehrere Teilnehmer wichen ihm aus – um nicht zu kollidieren und aus Sorge, von Penis-Schlamm bespritzt zu werden. An den sechs Stationen des Wegs wurde gesprochen – oft nicht über Christus. Vor dem Berliner Dom redete ein Klimaforscher. „Wir haben eine veritable Klimakatastrophe“, sagte er und forderte: „Hört auf Luisa!“ – gemeint war Neubauer. Dann Sätze, die mehr gefühlt als verstanden werden wollten. „Kein Mensch ist illegal“ und „Solidarität ist unteilbar“. Liturgisch korrekt, mit der Inbrunst einer Messe. Am Bebelplatz, dem Ort der Bücherverbrennungen des NS-Regimes, kam eine Imamin in Hijab zu Wort. Sie suggerierte, Christen seien die Hauptverantwortlichen für das Leid der Muslime in Deutschland. Auch sprach sie über Kunstfreiheit, die die Nazis hier verletzt haben, und wies darauf hin, dass auch die Freiheit von Frauen in Afghanistan stetig abnehme. Ihre Mutter habe noch einen Minirock tragen dürfen, ihre eigene Generation nicht mehr. Warum sie selbst – offensichtlich – von dieser Freiheit in Deutschland keinen Gebrauch macht, erwähnte sie nicht.
Zum Schluss in der Hedwigs-Kathedrale: eine jüdische Stimme – aber nur in absentia. Eine evangelische Pfarrerin verlas einen Brief, statt dass eine Jüdin selbst sprach. Es war ein Symbol unter vielen: Stimmen wurden ersetzt, Inhalte verschoben, Rollen getauscht.
Was bleibt? Die Grenzen zwischen Spiritualität, Moral und Aktivismus sind fließender geworden. Der Begriff der Schuld war spürbar. Nicht individuell, sondern kollektiv. Und das Bedürfnis, sie öffentlich abzutragen – durch Haltung, Gesten, Parolen. Eine Art säkulares Bußritual. Andacht oder Aktion, man weiß es nicht. Wer hier mitlief, wusste, was zu sagen, was zu fühlen war. Es gab kaum Grauzonen, kaum Jesus Christus – nur das Helle der Guten. Es ist nicht die Kirche, die sich hier neu erfindet, sondern ein neuer Ritus, der sich ihrer Symbole bedient: das Kreuz als Projektionsfläche für soziale Anliegen, die Prozession als Bühne für gesellschaftliche Erregung. Das mag ehrbar gemeint sein. Doch wo Christus fehlt, bleibt das Kreuz leer.
Vielleicht ist es das, was Julia Klöckner meinte, als sie der Kirche den Verlust an Substanz vorwarf. Vielleicht sollte die Kirche sich wieder erinnern, worin ihre Kraft liegt: im Bekenntnis – nicht zur Welt, sondern zu Gott.
[Carl-Victor Wachs, Jahrgang 1991, ist Journalist und Kommunikationschef der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Er studierte Sprachwissenschaften an der Universität Cambridge und ist Altstipendiat des katholischen Cusanuswerks. Von 2021 bis 2023 war er Bundestagskorrespondent der „Bild“.]