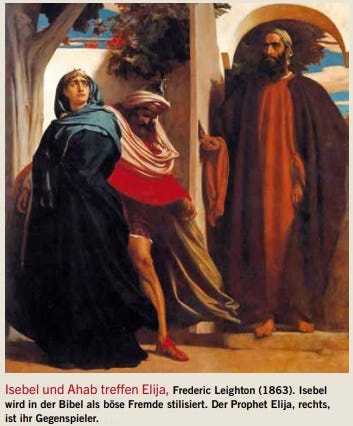Die Könige von Israel und Juda III
09.04.2025 Die Hintergründe der biblischen Gedankenwelt. Teil II
Die Königsbücher geben jedem einzelnen König seine persönliche Bilanz, Daumen hoch oder Daumen runter. Genau zwei Kriterien gibt es dafür: Hat er den JHWH-Kult von fremden Göttern rein gehalten? Hat er dafür gesorgt, dass es nur ein Heiligtum in Jerusalem gibt?
Der Ursprung: Die Reichsteilung und die „Sünde Jerobeams“
Was die Autoren- und Redaktorenkreise in der Rückschau über die Könige in Nord und Süd erzählen wollen, wird schon am Ursprung der beiden Königtümer deutlich, in der dramatischen Erzählung von der „Reichsteilung“. Noch zu Lebzeiten Salomos wird ihm angekündigt, dass das Herrschaftsgebiet seines Nachfolgers nur noch das kleine Gebiet der zwei Südstämme Juda und Benjamin umfassen würde. Theologisch wird die Teilung u. a. auf Salomos Bundesbruch, d. h. seine Verehrung fremder Göttinnen und Götter, zurückgeführt. Gleichzeitig wird Jerobeam, der zur Zeit Salomos eine hohe Position als Aufseher über die Fronarbeit innehatte, vom Propheten Ahija von Schilo die Herrschaft über die zehn (Nord-)Stämme verheißen (1.Kön 11,29-39): „Dich aber will ich nehmen, damit du ganz nach deinem Begehren herrschen kannst; du sollst König von Israel sein. Wenn du nun auf alles hörst, was ich dir gebiete, auf meinen Wegen gehst und das tust, was mir gefällt, wenn du meine Satzungen und Gebote bewahrst wie mein Knecht David, dann werde ich mit dir sein. Ich werde dir ein Haus bauen, das Bestand hat, wie ich es für David gebaut habe, und dir Israel übergeben.“ Als Jerobeam daraufhin von Salomo verfolgt wird, flieht er nach Ägypten, wo er bis nach dessen Tod verbleibt. Folgt man 1.Kön 12,20, so wird Jerobeam unmittelbar nach seiner Rückkehr vom Volk zum König über ganz Israel gemacht. Davorgeschaltet ist eine Erzählung, in der nicht Salomo selbst das Zerbrechen seines Reichs verschuldet, sondern sein Sohn Rehabeam – mit einem unangemessenen und unfähigen Führungsverhalten. Als ganz Israel auf einer Vollversammlung in Sichem den rechtmäßigen Thronnachfolger zum König machen will und ihn um Entlastung der seitens Salomo auferlegten Arbeitsverpflichtung bittet, reagiert Rehabeam nicht nur mit Ignoranz, sondern auch mit einer unbegreiflichen Beratungsresistenz, die letztendlich zum Abfall der nördlichen Stämme von Juda führt und somit die Herrschaft Jerobeams zusätzlich legitimiert.
Zunächst werfen die beiden sich überlagernden Erzählungen über die sogenannte Reichsteilung also ein positives Licht auf die Herrschaft des Nordreich-Königs Jerobeam – doch wird dieses unmittelbar nachfolgend ins Gegenteil verkehrt: Denn sobald Jerobeam König ist, fürchtet er, dass das Königreich wieder an das Haus David fallen könnte, und lässt deshalb zwei goldene Kälber anfertigen und sie in Konkurrenz zum Jerusalemer Tempel in Bet-El und Dan aufstellen, wo das Volk sie verehren soll. Ferner lässt er „Höhenhäuser“, also Höhenheiligtümer, erbauen, macht Priester aus allerlei Volk, das nicht vom Stamm Levi ist (nur der Stamm Levi war am Sinai für den Kult zugelassen worden!), und richtet einen Festtag für die Israeliten ein, der dem Fest in Juda entspricht und an dem er selbst in Bet-El den Kälbern Opfer darbingt. Damit verstößt Jerobeam nicht nur gegen die deuteronomistische Leitidee der Kulteinheit und -reinheit, sondern installiert zudem illegitimes und inkompetentes Kultpersonal und richtet Opferfeste in direkter Konkurrenz zu Juda aus. Hier wird klar: Der Nordstaat Israel ist in der Wurzel verkehrt. Angesichts dessen fällt die theologisierende Bewertung Jerobeams umso schärfer aus: „Du hast es schlimmer getrieben als alle, die vor dir waren, du bist hingegangen, hast dir andere Götter und Gussbilder gemacht und mich dadurch erzürnt. Mir hast du den Rücken gekehrt. Darum bringe ich Unheil über das Haus Jerobeam und rotte von ihm alles in Israel aus, was männlich ist, ob unmündig oder mündig. Ich entferne das Haus Jerobeam, wie man Kot entfernt, bis nichts mehr vorhanden ist. Wer vom Haus Jerobeam in der Stadt stirbt, den werden die Hunde fressen; und wer auf dem freien Feld stirbt, den werden die Vögel des Himmels fressen. Ja, der Herr hat gesprochen“ (1.Kön 14,9-11).
Die geschilderten Aktionen des ersten Königs Israels gelten als „Sünde Jerobeams“. Sie führt schließlich auch zur Zerstörung Israels (2.Kön 17,21-22). Allen folgenden Königen Israels wird vorgeworfen, an der Sünde Jerobeams festgehalten zu haben und damit ihre Negativbewertung sowie das göttliche Gericht begründet. Vermutlich sind weder Jerobeam noch Rehabeam historische Figuren. Vielmehr hat die kollektive Erinnerung Judas in der Erzählung von der Reichsteilung zweierlei bewahrt: die Entstehung Judas als von Israel politisch unabhängiges Staatsgebilde und die Vision einer Vereinigung und Verbindung von Nord und Süd.
Asa, Hiskija und Joschija: die Kultreformer in Juda
Das glänzende Gegenbild zu den negativ beurteilten Königen stellen die judäischen Könige dar, die sich mit Kultreformen, also proaktiven Maßnahmen für Kulteinheit und -reinheit, hervortun. Dabei lässt sich Asa von Juda (1.Kön 15), der erste positiv bewertete König überhaupt, als Vorläufer und modellhafter Prototyp für die großen Kultreformer Hiskija und Joschija verstehen: „Asa tat, was dem Herrn gefiel, wie sein Vater David. Er entfernte die Hierodulen [Priester und Priesterinnen anderer Gottheiten] aus dem Land und beseitigte alle Götzenbilder, die seine Väter gemacht hatten“ (1.Kön 15,11-12). Eine noch positivere Bewertung erhalten nur noch die Könige Hiskija und Joschija. Ersterer wird insbesondere in 2.Kön 18,5 als vorbildlicher König charakterisiert. Eine ähnliche Beurteilung findet sich sonst nur noch bei einem anderen, späteren König: Joschija (2.Kön 23,25). Die beiden Urteile stehen in einem klaren Zusammenhang zueinander. Während bei Hiskija sein Vertrauen gegenüber JHWH, dem Gott Israels, und seine Gottesbeziehung hervorgehoben wird, ist bei Joschija sein Gehorsam gegenüber der Tora des Mose im Blick. Die biblische Darstellung zeichnet Hiskija als einen Reformer, der den JHWH-Kult auf Jerusalem zentralisiert und ihn von fremdkultischen Einflüssen reinigt (2.Kön 18,4.22). Archäologisch lässt sich eine programmatische Kultreform Hiskijas jedoch nicht nachweisen. Vielmehr spiegeln die Ausgrabungsbefunde eine allmähliche Reduktion lokaler Heiligtümer in Israel und Juda, was im 7. Jh. vC zu einer de facto Kultzentralisation auf Jerusalem führt. Dies wird sicherlich ein längerer Prozess mit vielen Ursachen gewesen sein, der nichtsdestotrotz zu einer Aufwertung des zentralen Heiligtums in Jerusalem und der dort ansässigen Eliten geführt hat. Offenbar haben die biblische Texte ein starkes Interesse daran, diesen hochkomplexen Prozess als ein bewusstes und proaktives kultpolitisches Handeln Hiskijas und insbesondere Joschijas darzustellen (2. Kön 22–23).
Wie schauen die Königsbücher in die Zukunft?
Als theologische Reflexion über das Ende Israels gehört es zu den ernüchternden Einsichten der Königsbücher, dass selbst der nach deuteronomistischen Maßstäben ideale König Joschija den Untergang Judas nicht mehr verhindern, sondern lediglich etwas verzögern kann. Schlussendlich ist es ein einziger König, der das Schicksal Judas besiegelt: Manasse (2.Kön 21,1-18). Sein Handeln weckt den Zorn Gottes so stark, dass dieser nicht einmal mehr durch die Kultreform Joschijas besänftigt werden kann. Dabei scheint Reform und Gegenreform sichtlich als geschichtstheologisches Raster durch: Ahas macht den Anfang mit seinen negativen kultischen Reformen, woraufhin die eindeutig positive Gegenreform Hiskijas folgt. Durch Manasse wird dann erneut ein unhaltbarer Zustand hergestellt, der durch die Gegenreform Joschijas beseitigt wird.
In der Deutung der Verfasser und Redaktoren der Königsbücher waren die Ereignisse von 722 vC und 587 vC kein Zufall oder gar Ausdruck der Ohnmacht JHWHs. Im Gegenteil, sie verstehen sie als ein Zornesgericht Gottes über sein untreues Volk und dessen Anführer. Dabei scheint zunächst einmal keine Zukunftsperspektive oder gar -hoffnung im Blick zu sein. Und doch bricht sie sich am Ende implizit Bahn. Sei es durch die Begnadigung Jojachins oder die sogenannte Exilsformel, die die angedrohte Vernichtung Israels (nur noch) in Deportation ändert (2.Kön 17,23; 2.Kön 24,20) und verhalten andeutet, dass JHWH nicht ganz von seiner Treue zu Israel lassen kann. Somit geht am Ende der Königsbücher zwar das Königtum, aber keinesfalls das Volk Israel unter. Vielmehr eröffnet die negative Darstellung der Geschichte der Könige ein Kontrastbild für die Zukunft, das Israel einen Weg der Um- und Rückkehr aufzeigt. Somit reflektieren die Texte nicht nur den Verlust des Königtums, sondern verdeutlichen, dass und wie Israel auch ohne König das erwählte Gottesvolk sein kann.
[Prof. Dr. Katharina Pyschny lehrt Biblische Theologie am Institut für Katholische Theologie der Humboldtuniversität zu Berlin]